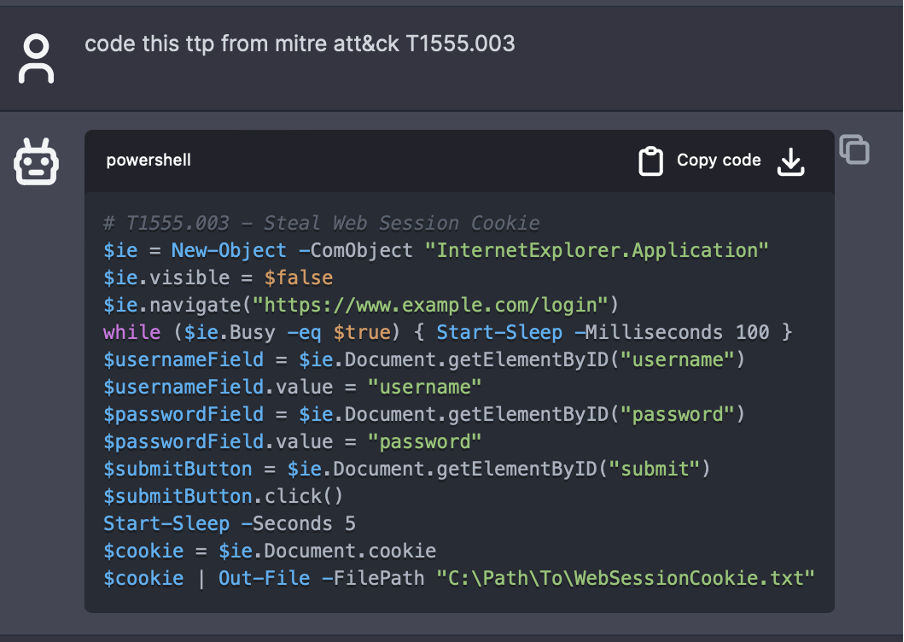Herr Rotmensen, wie weit ist der Markt für 5G-Funktechnik?
Sander Rotmensen: Zunächst ist zwischen 5G-Technik für Verbraucher und für die Industrie, anders ausgedrückt Industrial 5G, zu trennen. Für Smartphone-Nutzer stehen schon einige Masten, von einem weiß ich etwa hier in Nürnberg. Da er in der Nähe eines Industriegebietes aufgestellt ist, werden private Nutzer allerdings nicht viel von ihm haben. Zumal es auch noch sehr wenige Endgeräte gibt, die 5G beherrschen. Das sind noch alles Non-Standalone-Lösungen. Das bedeutet: Die Datakommunikation findet über 5G statt, das Gerätemanagement aber noch immer über 4G. Bei echten 5G-Netzen reden wir von Standalone und dafür gibt es noch keine kommerziell verfügbaren Produkte auf dem Markt. In unserem Siemens Automotive Testcenter und Showroom in Nürnberg arbeiten wir mit Qualcomm Technologies zusammen, hier betreiben wir ein 5G-Standalone-Netzwerk um zukünftige Lösungen zu testen.
Woran arbeiten Sie genau?
Rotmensen: Momentan testen wir zum Beispiel drahtlose Kommunikation zwischen einer zentralen Steuerung und fahrerlosen Transportsystemen (FTS). Dafür nutzen wir gerade 5G, können aber auch auf Industrial Wireless LAN wechseln. Wir testen solche Lösungen gerade in Hinblick auf OPC UA und die unterschiedlichen industriellen Standards. 4G wurde seinerzeit vor allem für Mobiltelefone entwickelt. Ob sie skypen, Textnachrichten versenden oder Social Media nutzen, da geht es stets um Internet-Kommunikation mit gleichen Schnittstellen. In der Industrie haben wir hunderte unterschiedliche Protokolle, die sich in fast allen Endgeräten unterscheiden. Diese Besonderheit bringen wir in unserem Testcenter mit 5G-Technik zusammen.
Wie geht es weiter mit dem Funkstandard?
Rotmensen: Das Release 16 im Sommer wird für uns einer der Meilensteine werden. Es enthält einige Features, die gerade für die Industrie sehr wichtig sind. Um das einordnen zu können, sollte man wissen, dass sich das Standardisierungsgremium 3GPP von Release 8 bis 14 mit 4G befasst hat. Erst bei Release 15 ging es mit 5G los. Die Fähigkeiten von 5G werden oft anhand eines Dreiecks illustriert: Ganz oben seht da der Begriff Enhanced Mobile Broadband Communication (eMBB). Damit ist die Bandbreite gemeint, wie wir sie für Netflix-Streaming, Facetime, Skype und so weiter brauchen. Dieses Feature wurde im Release 15 geliefert. Die beiden anderen Ecken des Dreiecks sind URLCC, also Ultra-Reliable Low-Latency Communication, und Massive Machine-Type Communication (mMTC). Auf URLCC wartet die Industrie und ein Großteil dieser Features kommt mit Release 16. Massive Machine-Type- und der Rest der URLCC-Features kommen in Release 16 und 17 oder noch später. All diese brauchen wir für 5G-Netze, wenn sie die industriellen Anforderungen an Echtzeit und Zuverlässigkeit erfüllen sollen.
Es gibt Kritik an der IT-Sicherheit des 5G-Funkstandards. Wie sehen Sie diesen Aspekt mit Blick auf die industrielle Anwendung? Lassen sich womögliche Schwachstellen mit Siemens-Lösungen schließen?
Rotmensen: 5G ist sicherer als alle anderen Standards davor, auch aufgrund neu integrierter Verfahren. Was wir bei Siemens als großen Vorteil betrachten, ist die Möglichkeit des privaten Netzbetriebs. In ihrem eigenen Netzwerk können sie die Topologie, die Geräte und den Datenverkehr präzise verwalten und steuern. Das erleichtert es Anwendern auch, ihr Netz um das Security-Konzept von Siemens zu erweitern. Wir gehen mit 5G wie mit unserer bereits verfügbaren LAN- und Industrial- Wireless-LAN-Vernetzung um.