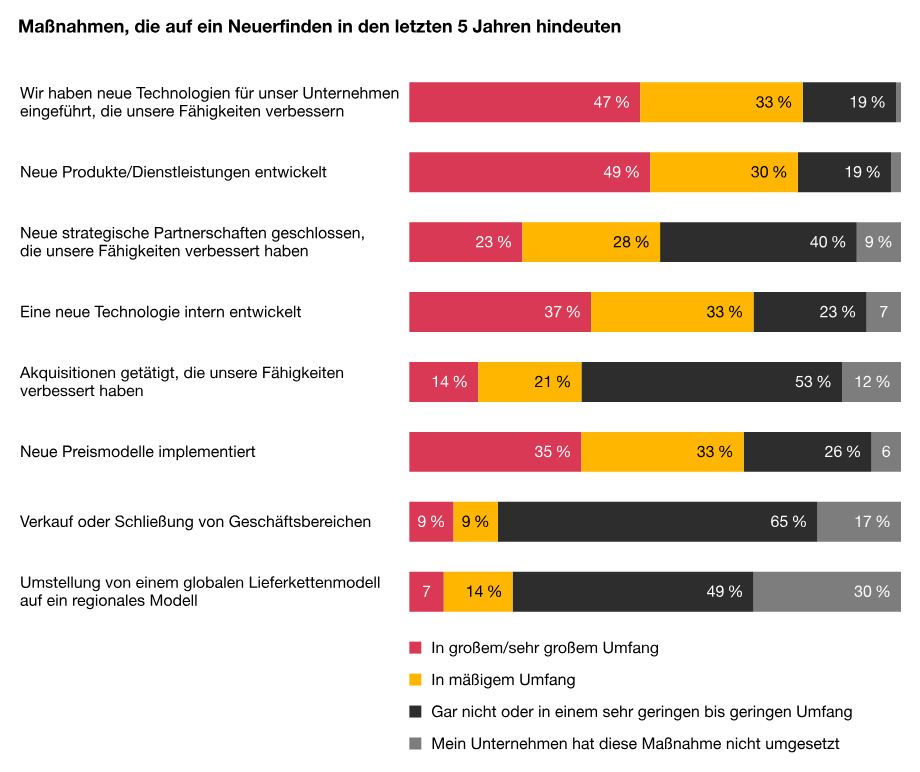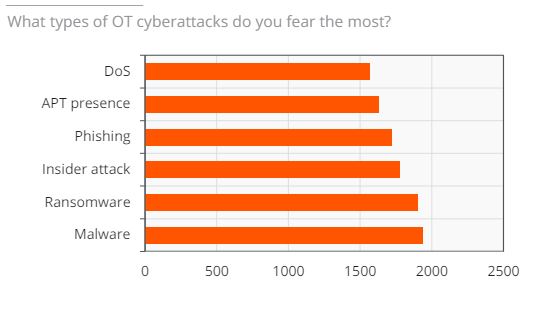Use Case Factory Automation
Aktuelle Gerätegenerationen, Schnittstellen und Verkabelungskonzepte sind von den Standardisierungsbemühungen also nicht unmittelbar betroffen. Hersteller von Sensoren und Aktoren sowie von Steuerungen und Feldgeräten beschäftigen sich jedoch schon heute im Design-in-Prozess mit der Geräte-Generation, die erst in zwei bis drei Jahren Marktreife erlangt. Die durchgängige Ethernet-basierte Kommunikationsstruktur ist gerade für Hersteller von Feldgeräten schon heute ein wichtiges Argument. Auch die hohen Übertragungsdistanzen von bis zu 1.000m sowie die Möglichkeit, Daten und Leistung von bis zu 60W über nur ein Aderpaar (PoDL – Power over Dataline)zu übertragen, sind Schlüsselargumente für SPE in zukünftigen Gerätegenerationen. Phoenix Contact bietet mit seinem Steckverbinderkonzept ein durchgängiges steckkompatibles System an, das kompakt baut und das dem Gerätehersteller erlaubt, möglichst wenig Platz auf der Leiterplatte in Anspruch zu nehmen und damit kleinere Geräte zu bauen. Das Steckverbinderkonzept basiert auf IEC63171-2 für IP20-Applikationen in der Gebäude- und Schaltschrankverkabelung und auf IEC63171-5 für IP67-Applikationen in der Feldebene der industriellen Anwendungen. Außerdem treibt Phoenix Contact die Normierung der entsprechenden Schnittstellen voran. Gemeinsam mit anderen Marktbegleitern – Belden, Fluke Networks, Reichle & De-Massari, Rosenberger, Telegärtner und Weidmüller – entwickelt der Anschlusstechnik-Spezialist geschützte und ungeschützte Steckgesichter für einpaarige und vierpaarige Leitungen. Darüber hinaus treibt Phoenix Contact das Thema der gesamten SPE-Infrastruktur über die ‚SPE System Alliance‘ voran, zu der mittlerweile mehr als 15 führende Technologieunternehmen aus verschiedenen Branchen und Anwendungsbereichen zählen, die ihr SPE-Knowhow bündeln und zielgerichtet austauschen. Auch der Wunsch nach Kostenersparnis treibt die Reduzierung auf nur ein Aderpaar maßgeblich voran. Ein im oben erwähnten Konsortium entwickelter Use Case für den Bereich Factory Automation zeigt, dass SPE mögliche Kosteneinsparungen von mehr als 25 Prozent im Vergleich zu modernen modularen Maschinenkonzepten mit sich bringt. Die Kosteneinsparungen liegen nur begrenzt bei den Komponenten, sondern vielmehr in der konsequenten Nutzung der SPE-Technologie. Alle Komponenten der Maschine können dann digital miteinander kommunizieren. Darin liegt der eigentliche Vorteil bei der Kosten-Nutzen-Analyse, denn der Status jeder einzelnen Komponente der Maschine kann jederzeit und von jedem Ort abgerufen werden. Die Vorteile – Gewichtsreduktion der Kabel, Miniaturisierung und Vereinfachung der Anschlusstechnik – kommen erst mit der Durchgängigkeit der gesamten Infrastruktur zum Tragen. Die Netzwerkstruktur in allen Applikationsbereichen, von der Gebäudeautomatisierung über die Fabrikautomation bis hin zur Prozessautomation, wird von dieser Innovation beeinflusst. Niemand sollte in diesem Kontext außer Acht lassen, dass es sich bereits heute entscheidet, wohin das Ethernet in Zukunft geht.
IEC63171-2: SPE-Steckgesichter für IP20
IEC63171-5: SPE-Steckgesichter für IP67
ISO/IEC11801-1: Allgemeine Anforderungen für Twisted-Pair- und Glasfaserkabel
Single Pair Ethernet – auf einen Blick
Das Single Pair Ethernet (SPE) beschreibt die physikalischen Schnittstellen zur einpaarigen Übertragung von Daten und Leistung zwischen unterschiedlichen Kommunikationsteilnehmern.
Das IEEE erarbeitet Normen für unterschiedliche Anwendungen mit Datenübertragungsraten von 10 (802.3 cg), 100 (802.3 bw) und 1000MBit/s (802.3 bp) sowie für Leitungslängen von 15 bis 1.000m.