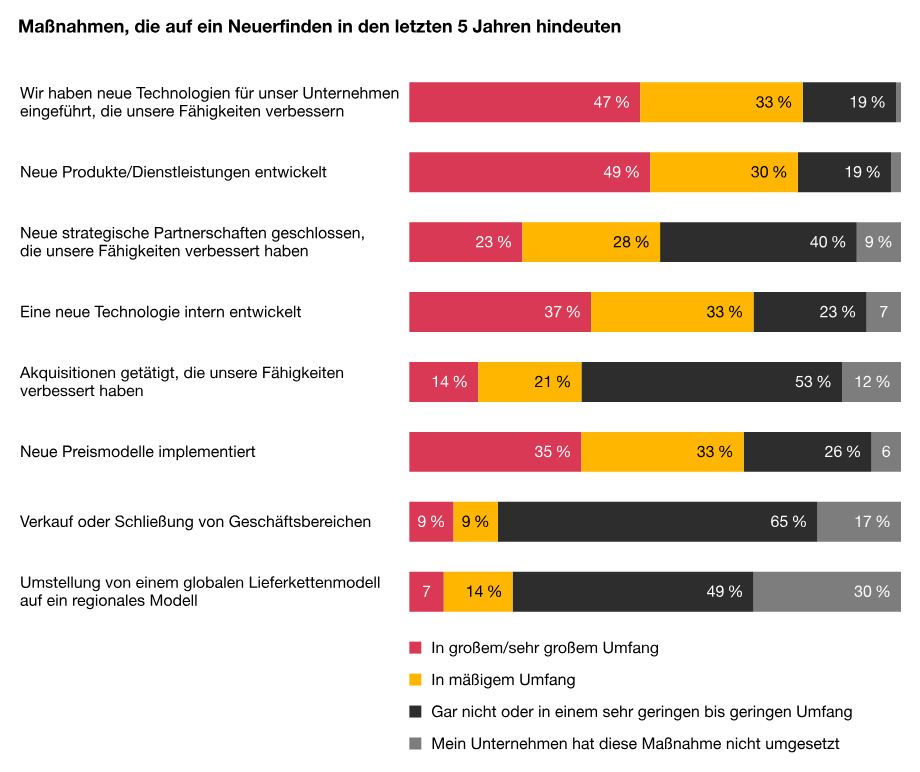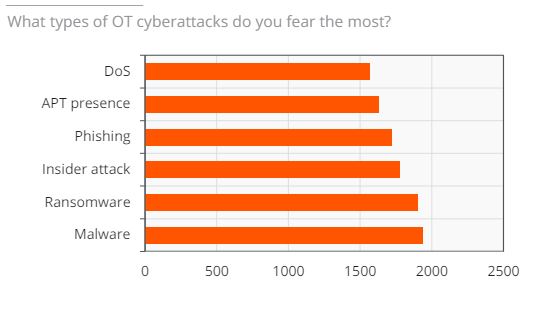Herr Reger, wie sind Sie auf die Idee gekommen,
ein Robotik-Startup zu gründen?
David Reger: Eigentlich wollte ich in den Automotive-Bereich. Aber dann hatte ich die Chance auf einen spannenden Job bei einem Unternehmen in der Schweiz. Ein tolles Familienunternehmen, das sehr erfolgreich in der Blechbearbeitung ist. Der Chef dort wollte etwas Neues rund um Robotik machen. Ich habe dort eine Menge gelernt und diesem Unternehmen wirklich viel zu verdanken. Wir konnten nach einem Jahr Arbeit auf der Messe Automatica einen Schwerlastroboter mit 150kg Traglast zeigen, alles von uns als Drei-Mann-Team konstruiert und gebaut. Wir haben damals auch einen der ersten Cobots entworfen. Dort hat meine Passion für Roboter begonnen.
Jetzt haben Sie Ihr eigenes Robotik-Startup.
Wie ist es als Gründer in Deutschland?
Reger: Hier in Deutschland, eigentlich in ganz Europa, ist es oft noch schwer, wenn man Visionär ist und Ungewöhnliches vorhat. Hier heißt es oft: Jetzt komm mal auf den Boden und bau erst mal das, was du schon kannst. Und das ist genau das, was wir nicht machen wollten. Deshalb haben wir zum Start keinen Investor aus Europa gesucht.
Ihr Investor, Han’s Robot, kommt aus China.
Warum kein Venture Capital aus den USA?
Reger: Wo sind derzeit die größten Märkte für Roboter? Asien und Europa. Ein deutsches Unternehmen mit Partnern in China vereint diese Regionen. Und speziell China hat noch den Vorteil, dass dort die Produktionstechnik extrem stark ist. Wer fast jedes Handy weltweit baut, der weiß einfach, wie Kosteneffizienz und Qualitätssicherung funktionieren. Das hilft uns, unsere Produkte in den Markt zu bringen.
Sie sagen, der kognitive Roboter sei ein
Quantensprung und kann die Robotik revolutionieren.
Das sind starke Worte. Wann soll das so weit sein?
Reger: Ich sehe das nicht in weiter Ferne. Ich bin überzeugt, dass wir in wenigen Jahren, vielleicht fünf, Roboter auch verstärkt in privaten Haushalten sehen werden. Aber derzeit sind unsere Hauptzielgruppen natürlich Bereiche, die von Automatisierung schon gehört haben, Industrie, Logistik, Manufakturen. Revolutionieren wollen wir diese Bereiche, indem wir den Einsatz der Robotik wirklich einfach machen. Mit unseren Systemen braucht man schon heute keinen teuren Ingenieur mehr, um sie anzuschließen und einzurichten.
Aber wie wollen Sie das machen? Robotik ist komplex.
Reger: So wie es aktuell ist natürlich schon: Der Roboter ist nur ein Arm und man braucht extra Sensorik, Schnittstellen zur Maschine und vieles mehr. Jeder Maschinenhersteller hat proprietäre Systeme, die nötigen Anpassungen kosten eine Menge Geld. Das sind die Dinge, die man bei einem kognitiven System nicht mehr braucht. Unser kognitiver Roboter Maira interagiert nicht nur mit dem Menschen, er interagiert auch mit der Umwelt, den anderen Maschinen. Wir können also sagen: Wenn diese Lampe an der Maschine rot leuchtet, dann greif rein und hole das Werkstück – so wie Menschen mit Maschinen eben auch interagieren. Wir haben Sensorik und Kameratechnik bereits integriert. Und wir haben hinter all dem eine künstliche Intelligenz, neuronale Netze, direkt auf dem Robot-Controller, um all das auszuwerten und zu steuern. Ohne Mehrkosten. Das halten wir für revolutionär und es wird nicht nur die Basis für einen breiteren Einsatz in der Industrie, sondern mittelfristig auch der Eintritt in Küche und Wohnzimmer. Davon bin ich überzeugt.