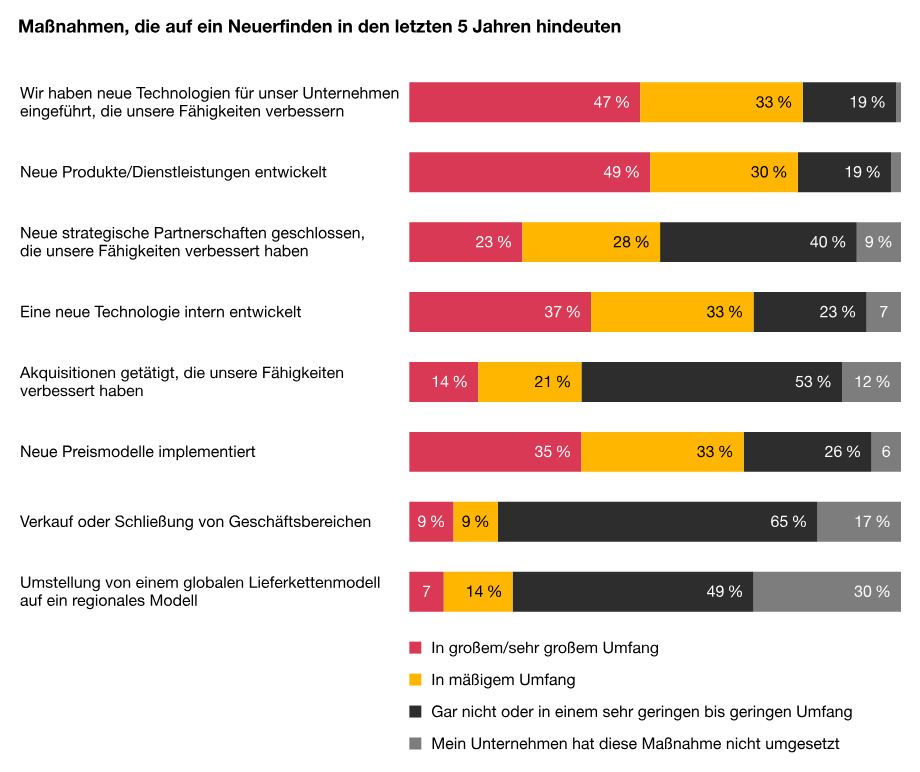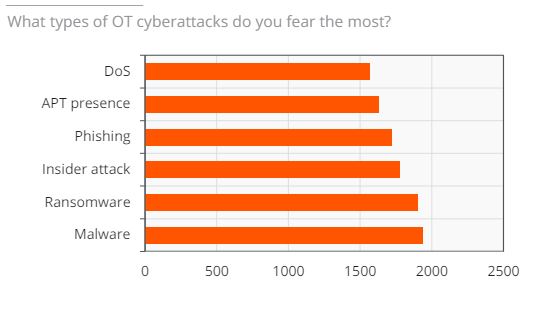Lärm, spritzendes Metall, Geruch nach Verbranntem: So stellt man sich Schweißen vor. Dass es auch ohne diese unangenehmen Begleiterscheinungen geht, beweisen die Maschinen der SST Steigerwald Strahltechnik: Dort hört und riecht man nichts, man sieht auch nicht viel. In der großen Kammer, deren Inneres durch ein Fenster sichtbar ist, zieht nur ein gleißender Strich aus Licht seine Bahn. In weniger als einer Minute umrundet er die Welle einer Flugzeugturbine, auf der ein mächtiges Schaufelrad steckt. Dann verschwindet das Licht, und die Naht zwischen Welle und Rad sieht so aus wie vorher. Doch das täuscht: Die vorher lose zusammengesteckten Teile sind nun fest verbunden, geschweißt mit einem unsichtbaren Elektronenstrahl, der tief ins Metall eingedrungen ist und sogar Metallblöcke dick wie Ziegelsteine verbindet.

Einsatz in der Luftfahrtindustrie
Karl-Heinz Steigerwald hat die erste Bearbeitungsmaschine mit Elektronenstrahlen für die Industrie im Jahr 1952 vorgestellt. Mit diesen Maschinen war es erstmals möglich, Werkstücke auch tief im Inneren zu schweißen und nicht nur an der Oberfläche. Bis zu 150mm tief dringt der Elektronenstrahl ins Metall ein. Dabei ist der Wärmeeintrag gering, das ist wichtig bei Bauteilen, die sich durch Hitze nicht verziehen dürfen – und deshalb sieht der Schweißvorgang auch so unspektakulär aus. Das Elektronenstrahlschweißen ist oft der letzte Bearbeitungsschritt eines Bauteils, weil es keine Nachbearbeitung der Schweißnaht braucht und sich nichts verformt. Es ist vor allem in der Luft- und Raumfahrtindustrie verbreitet. „Alles, was sich in Triebwerken dreht, wird mit Elektronenstrahlen geschweißt“, sagt Marko Wittig. Und zwar meistens mit Steigerwald-Maschinen, wie der Vertriebsmanager von SST betont. Zwar verlassen nur etwa 15 Anlagen jedes Jahr die Werkshalle, dennoch positioniert sich SST als Marktführer in dieser Nische.
Auch die Automobilindustrie hat das Verfahren für sich entdeckt, unter anderem zum Härten von Oberflächen bei Nockenwellen und in der Elektromobilität, wo Kupferteile für Elektromotoren oder Hochstromkontakte auf diese Weise verbunden werden. Die Kammern für die Produktion von Mikrochips sind ebenso mit Elektronenstrahlen geschweißt, wie die Hohlkammern aus Niob, mit denen Forschungsinstitute wie das Cern in Genf oder das Desy in Hamburg Elementarteilchen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit bringen. Die Anlagen von Steigerwald können nicht nur schweißen, sondern auch bohren – und das in rasender Geschwindigkeit. Bis zu 3.000 Löcher pro Sekunde schießen sie in Bleche, die etwa als Filter fürs Kunststoff-Recycling verwendet werden. Das Tempo ist auch dringend nötig: So ein Filter kann 40 Millionen Löcher haben.
Oldies seit Jahrzehnten in Betrieb
Wenn man bedenkt, was diese Maschinen leisten, ist es schon erstaunlich, wie robust sie sind. Manche Kunden betreiben noch Modelle aus den 1980er Jahren, ohne große Reparaturen. Dazu tragen auch die elektrischen Verbindungssysteme bei. „Ich bin seit 32 Jahren im Unternehmen und sehe bei Kunden immer noch Maschinen von uns, die vor meiner Zeit in Betrieb gegangen sind und in denen immer noch die ersten Kabel arbeiten“, sagt Wolfgang Rudolf, Leiter Technik bei Steigerwald. Das liegt vermutlich auch daran, dass der Maschinenbauer ausschließlich Kabel von Lapp einbaut – von Ölflex-Steuerleitungen über Unitronic-Datenleitungen bis zu Steckverbindern und allerlei Zubehör. Seit wann die Zusammenarbeit zwischen Steigerwald und LAPP besteht, kann niemand mehr genau sagen – vermutlich begann sie in den 1980er-Jahren.
Dass die Beziehung fruchtbar ist und die Lapp-Produkte ihre Qualität seit Jahren beweisen, weiß man bei Steigerwald allerdings genau. Hinzu kommt, dass die Kunden von Steigerwald, darunter immer mehr Automobilhersteller, eine Liste führen mit bevorzugten Komponentenlieferanten, an die sich die Hersteller von Maschinen halten müssen. Und weil auf vielen dieser Listen bei Kabeln die Marke Lapp steht, ist es für Maschinenbauer wie Steigerwald ein sicherer Weg diese Leitungen flächendeckend einzubauen.
Probleme vermeiden
In den Anlagen von Steigerwald müssen die Kabel einiges aushalten. Erstmal die Bewegungen der Schleppkette, die in der Regel zwei Dutzend Kabel enthält, in Ausführungen mit beweglichem Generator in der Prozesskammer auch das Doppelte. Über diese Leitungen fließt Strom zum Bewegen des Werkstücks, für Sensoren und Daten – „das ganze Spektrum des Lapp-Katalogs“, so Einkaufsleiter Markus Scherer.